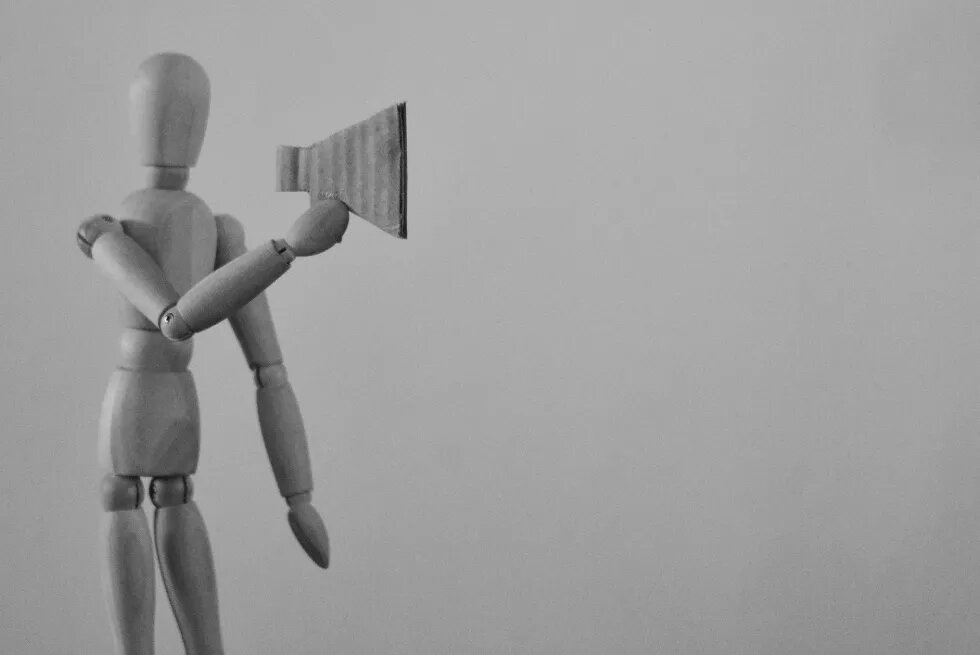In ihrem Vortrag analysiert Prof. Dr. Gudrun-Axeli Knapp die Verschiebung von Leitbegriffen innerhalb der feministischen Kritik. Den Vortrag als pdf können Sie hier abrufen.

Dieser Artikel ist Teil unseres einführenden Dossiers „Feminismus & Gender".
Ich habe den Vortrag unter die Überschrift gestellt: „Auf ein Neues!? Feministische Kritik im Wandel der Gesellschaft.“ Das Ausrufezeichen steht dafür, dass sich Kritik im Wandel der Gesellschaft immer wieder selbst erneuern muss. Theorien und Begrifflichkeiten der Gesellschaftskritik haben einen historischen Erfahrungsgehalt, einen „Zeitkern“ (W. Benjamin) und eine kontextuelle Signatur. Es ist gerade der Gegenwartsbezug von Kritik, der zu Veränderungen nötigt, wenn die Gesellschaft sich ändert. Insofern bleibt kritische Theorie kritisch nur dann, wenn sie in Anbetracht historischen Wandels nicht bleibt, wie sie ist. Dies gilt auch für die Begriffe und Perspektiven feministischer Theorie, einer der jüngeren Gestalten von Kritik in und an der 'modernen Gesellschaft'.
Das Fragezeichen hinter dem Ausruf „Auf ein Neues!?“ verweist aber noch auf einen anderen Aspekt. Perspektivveränderungen folgen nicht nur dem Wandel des Gegenstands oder der immanenten Logik theoretischer Lern- und Differenzierungsprozesse. In den Wenden und Wendungen der Theorie und den oft pathetischen Verabschiedungen überkommener Begrifflichkeiten reflektieren sich auch Kämpfe um Definitionsmacht. Diese sind geprägt von Machtdisparitäten und den jeweiligen institutionellen Bedingungen unter denen wissenschaftliches Wissen produziert wird. Auf diesem Hintergrund gilt, dass kritische Theorie kritisch nur bleiben kann, wenn sie den Wandel der Gesellschaft reflektiert, sich aber zugleich dem Druck zu bloß opportunen Veränderungen widersetzt. Beides setzt eine Überprüfung und reflexive Vergegenwärtigung überkommener Begrifflichkeiten im Geiste des Freud´schen „Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten“ voraus.
Akzentverschiebungen in den Leitbegriffen
In diesem Sinne will ich mit Ihnen eine Baustelle besuchen. Es geht um die Baustelle feministischer Kritik und um symptomatische Verschiebungen in deren Leitbegriffen. Einsteigen will ich mit dem Begriff des Patriarchats, dem zentralen Begriff feministischer Kritik in der zweiten Welle der Frauenbewegung in den 1970er und 80er Jahren.
„Patriarchat“ war vor allem ein politischer Kampfbegriff mit einem hohen mobilisierenden Potential. Aber auch als Begriff feministischer Gesellschafts-und Herrschaftsanalyse stand er eine Zeit lang im Mittelpunkt. Ungefähr ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mehrten sich die Stimmen, die seinen „Nutzen“[1] in Frage stellten. In der sich gerade institutionalisierenden Frauen- und Geschlechterforschung rückte der Patriarchatsbegriff spätestens mit den 1990er Jahren zunehmend an den Rand. Das aus der amerikanischen Soziologie und feministischen Theorie übernommene Gender-Konzept und konstruktivistisch-mikrosoziologische bzw. (de)konstruktivistische Ansätze gewannen dagegen an Bedeutung.
Danach lässt sich bei den zentralen Begriffen feministischer Kritik eine Art Weggabelung beobachten, die in zwei Richtungen führt:
Ein Teil der Phänomene, die vielleicht früher noch unter „patriarchalisch“ subsumiert worden wären, werden nun zumindest im „akademischen Feminismus“ (Sabine Hark) tendenziell eher unter dem Begriff des Androzentrismus gefasst. Er ist einerseits präziser als der manchmal sehr unspezifisch gebrauchte Patriarchatsbegriff, anderseits ist sein Einzugsbereich auch enger. Er fokussiert nicht mehr auf umfassende Herrschafts- und Strukturzusammenhänge, wie dies der mit dem Patriarchatsbegriff verbundene Anspruch war, sondern er richtet sich auf geschlechtsbezogene Strukturierungen kultureller Ordnungen und Legitimationsmuster.
Der andere Terminus, der sich allmählich in den Vordergrund schiebt und stärker als der Androzentrismusbegriff zwischen politischer und wissenschaftlicher Öffentlichkeit oszilliert, ist der Begriff des Sexismus.
Ich werde einige Schlaglichter auf die drei Begriffe (Patriarchat, Androzentrismus, Sexismus) werfen. Da die Diskussion zum Patriarchatsbegriff am weitesten zurückliegt, behandele ich sie etwas ausführlicher als die anderen beiden Konzepte.
Anschließend werde ich auf eine aktuell viel diskutierte weitere Weggabelung in der Entwicklung feministischer Kritik eingehen: der eine Weg führt in Richtung Intersektionalität, der andere ist der Weg queerfeministischer Kritik der zweigeschlechtlichen Ordnung.
Ich werde argumentieren, dass beide Entwicklungen produktiv waren und sind, dass sie feministische Kritik jedoch in Sackgassen führen können. Vor allem dann, wenn sie sich von deren klassischen Perspektiven isolieren und zu weit von den herrschafts- und gesellschaftstheoretischen Problemstellungen aus der Zeit der Patriarchatsdiskussion entfernen. Verdeutlicht werden soll aber auch, dass und warum das Patriarchatskonzept selbst nicht ohne Modifikationen wieder aufgenommen werden kann, als wäre nichts geschehen. Wichtig ist mir vor allem, Ihnen anhand der verschiedenen Konzepte einen Eindruck der systematischen theoretischen Probleme zu vermitteln, mit denen feministische Kritik es gegenwärtig zu tun hat.
Patriarchat/ Patriarchalismus
Der Patriarchatsbegriff ist keine Erfindung der Frauenbewegung oder des „akademischen Feminismus“ (Hark), sondern ein Begriff mit einer sehr langen außer- und vorfeministischen Geschichte. Von den Staatstheoretikern des 17. Jahrhunderts (Filmer, Locke) über die evolutionistischen Anthropologen des 19. Jahrhunderts (Bachofen, Morgan), über die sozialistischen Theoretiker Engels und Bebel, den Gründungsvater der Soziologie, Max Weber, über die ältere Kritische Theorie in ihren „Studien über Autorität und Familie“, den Sozialpsychologen Erich Fromm bis hin zum Soziologen René König und vielen anderen mehr gab es Versuche der Begriffsbestimmung und theoretische Ausarbeitungen, auf die sich auch feministische Wissenschaftlerinnen kritisch oder zustimmend bezogen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Phänomen patriarchaler Herrschaft ein wichtiger und legitimer Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses.
Max Webers historisch-soziologische Typologie der Herrschaftsformen bestimmt Patriarchalismus als Typus „traditionaler Herrschaft“, der durch den „Alltagsglauben“ an die Legitimität „alt überkommener Ordnungen und Herrengewalten“ (Weber) legitimiert wird. Mit Blick auf historisch und geographisch unterschiedliche Gesellschaftsformationen nimmt er eine Reihe von definitorischen Binnendifferenzierungen vor, auf die ich nicht näher eingehen kann. Hier ist nur der Hinweis wichtig, dass Max Weber seine Beispiele aus allen möglichen Weltgegenden und der weit zurückliegenden Vergangenheit nimmt. Das „Hausherrnpatriarchat“ seiner Gegenwart (um 1900), mit dem sich seine Ehefrau Marianne Weber in ihrer umfangreichen Studie zur „Stellung der Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung“ befasst hat, erwähnt er, wie Ute Gerhard (1990:69) notiert, mit keinem Wort.[2]
Ernst Manheims 1936 veröffentlichter Literaturüberblick über die Geschichte der autoritären Familie, in dem er sich auch mit dem Patriarchalismus auseinandersetzt, gehört zu den noch immer lesenswerten Expertisen, die am Frankfurter Institut für Sozialforschung im Rahmen der „Studien über Autorität und Familie“ verfasst wurden. Manheim definiert „Patriarchalismus“ als „variablen Komplex typischer Herrschaftsbeziehungen (…)“ in dem ökonomische und politische Macht konvergieren. „Es handelt sich hierbei um drei oft zusammenfallende, aber miteinander nicht identische Überordnungsverhältnisse: Den Geschlechts-, den Alters- und Dienstpatriarchalismus. Unter Geschlechtspatriarchalismus verstehen wir das herrschaftliche Verhältnis von Mann zu Frau, von Bruder zu Schwester, von Schwager zu Witwe, zuweilen von Sohn zu Mutter, kurz die geschlechtliche Unterordnung der Frauen innerhalb der Familie. Unter Alterspatriarchalismus soll die autoritäre Unterordnung der Jugend unter das Alter im häuslichen Maßstab verstanden werden. Der Dienstpatriarchalismus beruht auf der dauernden Kommandobefugnis des Hausherrn über die Leistungen der Hausgenossen – einerlei ob verwandt oder fremd. Geschlechts-, Alters- und Dienstherrschaft stellen oft nur verschiedene Funktionen einer ungetrennten Hausgewalt dar. Zuweilen aber treten sie auseinander und haben in der Tat verschiedene soziale Faktoren zur Lebensgrundlage und dementsprechend einen verschiedenen Ausübungsbereich.“ Manheim 1936:527)[3]
Sowohl Weber als auch Manheim liefern wichtige Anknüpfungspunkte für feministische Analysen patriarchaler Verhältnisse. Wie andere Theoretiker auch behandeln sie aber patriarchale Herrschaft eher als ein Phänomen der Vergangenheit. Eine feministische Kritik der Gegenwartsgesellschaft konnte daher nicht einfach daran anknüpfen. Sie brauchte (und braucht) ein umfassendes, empirisch gestütztes Verständnis des Formwandels und der Mechanismen patriarchaler Herrschaft, das bis in unsere Gegenwart reicht.
Und genau diese Analyse eines Formwandels patriarchaler Herrschaft in seinem Zusammenhang mit den übergreifenden wirtschaftlichen Veränderungen und den unterschiedlichen Formen staatlicher Herrschaft seit dem langen 19. Jahrhundert und im kurzen 20. Jahrhundert (Nationalsozialismus, Realsozialismus, Demokratie) liegt nicht vor. Zumindest nicht als synthetisierende Zusammenschau, die feministischer Gesellschaftskritik die historische Tiefenschärfe und begriffliche Differenziertheit geben würde, derer sie bedarf.
Man kann sagen, dass der Patriarchatsbegriff im „akademischen Feminismus“ (Hark) schon ausgemustert war, bevor das Desiderat erkennbar wurde, ihn als historisch-spezifischen und für vergleichende Forschung zu präzisierenden Begriff feministischer Herrschafts- und Gesellschaftsanalyse weiter auszuarbeiten.
Im deutschsprachigen Raum sind es, soweit ich sehe, vor allem zwei Wissenschaftlerinnen, die sowohl an einer historischen Spezifizierung des Konzepts patriarchaler Herrschaft gearbeitet als auch programmatisch an dem Desiderat einer Fortführung der Patriarchalismusanalyse festgehalten haben.[4]
Formwandel patriarchaler Herrschaft im langen 19. Jahrhundert
Ich spreche von der Rechtssoziologin Ute Gerhardt und ihrer Untersuchung „Verhältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert“ die schon 1978 erschienen ist und von der Soziologin Ursula Beer und ihrer Untersuchung „Geschlecht, Struktur, Geschichte. Soziale Konstituierung des Geschlechterverhältnisses“, die 1990 publiziert wurde. [5]
Beide befassen sich mit dem Formwandel patriarchaler Herrschaft im Übergang zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft: Beide bewegen sich mit ihren Studien im „langen 19. Jahrhundert“ (Hobsbawm), in dem sich die moderne Geschlechterkonstellation formiert.
Die feudale Agrargesellschaft wird in dieser Phase allmählich zur kapitalistischen Industriegesellschaft, die religiösen Legitimationsmuster einer gottgewollten hierarchischen Ordnung sind im Zuge von Säkularisierungstendenzen unter Druck geraten. Mit den revolutionären Ideen von Freiheit, Gleichheit, Solidarität, die in unterschiedlichen politischen Bewegungen und Parteien aufgenommen wurden, sind Vorstellungen in Umlauf gekommen, auf deren Hintergrund Verhältnisse der Unfreiheit, der Ungleichheit, Unterdrückung und Ausbeutung als historisch-veränderbare Ordnungen skandalisierbar werden.
Ute Gerhard untersucht die in Bewegung geratenen Verhältnisse unter einem spezifischen Blickwinkel. Sie fragt nicht nach dem Fortwirken feudaler Relikte des Patriarchalismus in der sich entfaltenden Industriegesellschaft, in der Arbeitskraft (wie gängige Geschichtserzählungen in androzentrischer Pauschalität behaupten) von feudalen Fesseln befreit zur „Ware“ wird. Gerhard interessiert sich für den spezifischen modernen bürgerlichen Patriarchalismus, der sich als politische Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen und das Vordringen der Gleichheitssemantiken formierte. In Anlehnung an eine Formulierung des Soziologen René König bezeichnete sie ihn als „Patriarchalismus im Gegenstoß“.
Damit soll deutlich gemacht werden, dass es hier nicht um Relikte der feudalen Tradition geht, sondern um etwas reaktives Neues, etwas reaktionäres Modernes. Das, was wir heute gerne als „traditionelle“ Form des Geschlechterverhältnisses bezeichnen, ist aus dieser Sicht gerade das Moderne.
„Eheherrliche Vormundschaft“ bis 1977 (Ute Gerhard)
Zwar rekurriert auch der bürgerliche Patriarchalismus auf ältere Begründungen der Nachrangigkeit von Frauen, die es ja schon in der Antike und in verschiedenen religiösen Überlieferungen gibt. Angesichts der gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen muss Ungleichheit aber in der bürgerlichen Gesellschaft anders legitimiert und befestigt werden. Und diese Legitimation geschieht nun zunehmend und mit neuer Vehemenz im Rekurs auf die Ordnung der Natur. Die Geschlechterordnung wird zur naturgegebenen Fügung, an der nicht zu rütteln ist. [6] In den Rechtsordnungen des modernen Staats wird die „von Natur aus“ hierarchisierte Differenz positiv gefasst und codifiziert.
Ute Gerhard verweist vor allem auf die zentrale Bedeutung des bürgerlichen Familienrechts, mit dessen Hilfe ein mittelalterliches Rechtsinstitut, die „Geschlechtsvormundschaft“ (Munt) speziell für Ehefrauen institutionalisiert wurde. Damit sicherte der bürgerliche Staat „den Ehemännern qua Recht die Verfügungsgewalt nicht nur über das Eigentum der Frauen, sondern auch über ihre Arbeit, ihren Körper, ihre Kinder und mit der berüchtigten ‚ehelichen Pflicht‘ auch über ihre Sexualität. Diese Form eheherrlicher Vormundschaft bleibt rechtswirksam im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 nur in Stufen abgemildert bis 1977.“ (Gerhard 1990:70) Ein Gutteil dieser in geltendes Recht gegossenen „Geschlechtsvormundschaft“ war noch in Kraft, als Frauen sich in den 1970er Jahren in Bewegung setzten. Gesellschaftskritik äußerte sich in der Ersten und Zweiten Frauenbewegung daher wesentlich auch als Rechtskritik. Rechtskritik, Wissenschaftskritik und Gesellschaftskritik stehen in einem Verweisungs- und Implikationszusammenhang.
Auch für Ursula Beer ist der moderne Patriarchalismus keine Reproduktion überkommener patriarchaler Verhältnisse, sondern ein neues Phänomen. Deshalb spricht sie vom „industriegesellschaftlichen Sekundärpatriarchalismus“ der aus dem Zusammenwirken des „familialen Sekundärpatriarchalismus“ mit einem „beruflichen Sekundärpatriarchalismus“ resultiert. Beide zusammen bestimmen den Zugang, die Chancen und die Art der Platzierung von Frauen im Privaten und in der Erwerbssphäre und damit auch den Zugang zum allgemeinen Tauschmedium „Geld“.
Die soziale Konstituierung des modernen Geschlechterverhältnisses
Der vorbürgerliche Patriarchalismus basierte in seiner idealtypischen Fassung auf der an Eigentum gebundenen Autorität eines „Hausherren“ über sämtliche Menschen (Frauen, Männer, Kinder), die zu einer Hauswirtschaft gehörten. Der bürgerliche Patriarchalismus spezifiziert und verbreitert diese Herrschaftsbasis durch rechtlich fixierte Kontroll- und Machtbefugnisse von allen Männern als Ehemännern.
Diese Herrschaftsbasis wurde erst etabliert mit der Abschaffung ständischer Ehebeschränkungen und der Verallgemeinerung der Heiratserlaubnis. Damit verallgemeinern sich erst in der so genannten modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auch patriarchale Herrschaftsverhältnisse: nun hat nicht nur jeder Grundherr oder gut situierte Bürger, sondern auch jeder verheiratete Arbeiter und kleine Angestellte eine Frau, über deren Arbeitskraft, Kinder, Körper und Sexualität er im rechtlich definierten Rahmen verfügen kann.
Die nachständische Form der Vergesellschaftung als „Frauen“ und „Männer“, also die moderne Gestalt des Geschlechterverhältnisses, formierte sich als bürgerliche Hegemonie im Zusammenspiel zwischen der ökonomischen Entwicklung zum industriellen Kapitalismus, der Trennung von Haushalt und Betrieb, rechtlich fixierten Formen (ehe)männlicher Vorrechte und Benachteiligung von Frauen im Eigentums-, Familien- und Arbeitsrecht. Legitimiert wurde die neue Ordnung im Zuge einer Verwissenschaftlichung der Geschlechterdifferenz und der durch sie im Rekurs auf Natur begründeten Formen der Arbeitsteilung und sozialen Platzierung.
Im Zuge dieser Entwicklung setzen sich bürgerlich-neopatriarchale Ordnungsvorstellungen von Staat, Familie, Arbeitsteilung auf breiter Ebene durch. Auch wenn im gelebten Leben für den größeren Teil der Bevölkerung Erwerbsarbeit von Frauen bis auf eine kurze Zeitspanne nach dem Zweiten Weltkrieg die Regel war, wird die bürgerliche Geschlechterideologie (das sogenannte „Ernährer-Hausfrau-Modell“) zur Norm, an der sich auch Arbeiter und die überwiegenden Teile ihrer politischen bzw. gewerkschaftlichen Interessenvertretungen orientieren. [7]
Die Vorstellung von harmonisch-komplementärer Geschlechterdifferenz und zwei einander ergänzenden, dabei implizit hierarchisierten, Aufgaben- und Kompetenzprofilen wird zur idealen Vorgabe und normativen Grundlage für viele politische Entscheidungen. In diesen politischen Entscheidungen, von denen Frauen bis zur Erreichung des Wahlrechts am 12. November 1918 ja weitgehend ausgeschlossen waren, kommt es immer wieder zu männerbündischen GroKos und Kompromissen über Parteigrenzen hinweg, die letztlich zu Lasten von Frauen gehen.
Geschlechterpolitische Weichenstellungen und deren Folgen
Ich nenne stichworthaft nur die wichtigsten Weichenstellungen, die bis heute – trotz erfolgter rechtlicher Gleichstellung und gravierender Veränderungen der normativen Vorstellungen von Geschlechtsrollen (vom Ernährer-Hausfrau-Modell zum Adult-Worker-Modell) Geschlechterungleichheit vermitteln, weil sie in die institutionelle Infrastruktur unserer Gesellschaft eingelassen sind.
- Die Ausrichtung des Rentensystems am Modell vollzeitlicher Erwerbsarbeit, die auf weibliche Erwerbsbiographien aus strukturellen Gründen noch nie gepasst hat und es bis heute nicht tut. Die disproportionale Beanspruchung von Frauen durch Arbeit im Haushalt, in der Kinderbetreuung und der Pflege der Alten auf der einen und ihre prekäre und diskontinuierliche Verankerung im Arbeitsmarkt auf der anderen Seite führen zur systematischen Schlechterstellung von Frauen und zum verbreiteten Phänomen der weiblichen Altersarmut.
- Ein geschlechtlich differenziertes Berufsbildungswesen, das in einen nach wie vor geschlechtlich segregierten Arbeitsmarkt mit geschlechtlich differenzierten Löhnen und Gehältern führt.
- Halbtagsschulen und Öffnungszeiten von Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen, die in ihrer Zeitökonomie voraussetzen, dass eine Betreuungsperson für Kinder nachmittags zur Verfügung steht.
- Die zeitliche Anforderungsstruktur der Berufswelt, die alle regenerativen und einen Teil der reproduktiven Belange ausblendet beziehungsweise in die Privatsphäre delegiert: Das Phänomen der sogenannten „Anderthalbpersonenberufe“, die in ihrer Zeitstruktur mindestens eine halbe Person unterstellen, die für die Regeneration und Reproduktion der Arbeitskraft sorgt.
Die vergleichende Erforschung solcher Strukturbedingungen und Institutionenregime unter den Bedingungen eines ungleichzeitig verlaufenden sozialen Wandels ist eine der zentralen Voraussetzungen für eine feministische Kritik der Gesellschaft. Das systematische Problem, das sich allen einschlägigen Untersuchungen stellt ist, den Widerspruch zwischen der zunehmend durchgesetzten rechtlichen Gleichstellung und dem Fortwirken von Dominanz und Ungleichheit im Geschlechterverhältnis auf den verschiedenen Ebenen gesellschaftlicher Strukturbildung zu begreifen. Ohne Einbeziehung aller Ebenen gesellschaftlicher Strukturierung (konventionell unterschieden als Mikro-, Meso- und Makroebene) und ohne historische Tiefenschärfe wird die geschlechtliche Strukturierung unsichtbar, die in den politischen Debatten zu Zeiten der Etablierung dieser Institutionenregime noch offenkundig war. Damit verfällt ein Teil der vergeschlechtlichten Strukturzusammenhänge einer Art gesellschaftlicher Unbewusstheit.
Nicht alle theoretischen Ansätze sind gleichermaßen geeignet, solche widersprüchlichen und von Ungleichzeitigkeiten durchzogenen Formationen zu erschließen. Der Blick durchs Mikroskop der Alltagspraktiken des „doing oder undoing gender“ macht andere Vorgänge sichtbar und unsichtbar als der makroskopische Blick auf die institutionellen Gleisanlagen des gesellschaftlichen Verkehrs und umfassende Strukturzusammenhänge, über die sich Differenzierungen und Ungleichheitslagen vermitteln. Gleichwohl sind die unterschiedlichen Zugänge aufeinander verwiesen. In jüngerer Zeit ist mit dem sogenannten „Cultural turn“ auch in der Geschlechterforschung das Interesse an der Mikrologie sozialer Praktiken deutlich gewachsen, während die andere Seite, der Blick auf großrahmigere historische Formationen und Strukturen an Schub- und Innovationskraft verloren hat. Das war bis zur Jahrtausendwende anders. Aus meiner Sicht gehört die Verknüpfung von Institutionentheorie, Gesellschaftstheorie und Lebenslaufforschung zu dem Anregendsten, was die soziologische Geschlechterforschung in Deutschland zur feministischen Analyse unserer Gesellschaft beigetragen hat. Sie hat das Phänomen der „Verzeitlichung“ sozialer Ungleichheit in seiner geschlechtlichen Strukturierung erhellt, sie hat die vergleichende Erforschung nationaler wohlfahrtsstaatlicher Regime befruchtet und es damit erlaubt, sowohl die Persistenz als auch die unterschiedlichen Pfade der Reproduktion geschlechtlicher Ungleichheit in ihrem Wandel besser zu begreifen.
Da der Begriff patriarchaler Herrschaft historisch sehr stark auf die Codierung von Geschlecht in Rechtsverhältnissen geeicht ist, sind konzeptionelle Differenzierungen unumgänglich. Ursula Beer schlägt den für ihren Analysezeitraum (das „lange 19. Jahrhundert“) stimmigen Begriff des „Sekundärpatriarchalismus“ vor. Wie weit und mit welchen Modifikationen man ihn sinnvollerweise in die Gegenwart hinein ausdehnen kann, ist eine offene Frage. Die Auseinandersetzung mit dieser begrifflichen Perspektive ist eher abgebrochen oder schleichend aufgegeben als durch eine plausible Antwort beendet worden. Insofern trifft Ute Gerhards Aussage von 1990 über patriarchatskritische Gesellschaftsanalyse als „nicht erledigtem Projekt“ auch heute noch zu.
Androzentrismus: „Der Mensch und sein Weib“
Ausgangspunkt und primärer Fokus der Forschungen, die sich auf den Begriff des Androzentrismus beziehen, sind die geschlechtsbezogenen Strukturierungen in den kulturellen Ordnungen oder im Bereich des Symbolischen. Die Frauen- und Geschlechterforschung war schon in ihren Anfängen nicht nur auf Lücken, sondern auch auf systematische Schlagseiten in den kulturellen Repertoires und im wissenschaftlichen Wissen gestoßen, die sich nicht einfach nach dem Rezept „add women and stir“ beheben ließen.
Den leitenden Vorstellungen von Geschlechterdifferenz liegt (oder müsste man heute sagen: lag?) eine spezifische Struktur von Allgemeinem und Besonderem zugrunde. Claudia Honegger hat sie in ihrer wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchung: „Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib“ (1991) nachgezeichnet und materialreich belegt. Sie arbeitet wissenshistorisch heraus, was auch in der feministischen Philosophie ein zentrales Thema war: dass es bei den Differenzsetzungen in der Moderne eben nicht um die Unterscheidung von einem und noch einem geht, die im Prinzip gleiche Geltung haben könnten, sondern dass es sich um identitätslogische Unterscheidungen von A und Non-A handelt. In Differenzsetzungen, die dieser Logik folgen, wird das Nicht-Identische zum konstitutiven Außen, zum „Anderen des Selben“ (Luce Irigaray), zur Abweichung, die die Norm und den Maßstab trägt, die selbst unmarkiert bleiben nach dem Muster „der Mensch und sein Weib“ (Claudia Honegger); „der Mensch und seine Anderen“.
Honegger spricht von einer systematischen „Inversion in der Herzkammer der Moderne“ (Honegger 1991, 12). Diese Inversion konstituiert einen ebenso folgenreichen wie schillernden Horizont herrschaftsförmiger Verweisungen, in dem Frauen als Besondere-Mindere-Andere adressiert werden konnten, während der Maßstab (Der Mensch), zwar implizit androzentrisch ausgerichtet, aber geschlechtlich unmarkiert bleibt. Frauen sind das Geschlecht, der Mann verallgemeinert sich zum Menschen an sich.
Der Schwerpunkt des Androzentrismus-Konzepts liegt auf den Wissens-Ordnungen und der geschlechtlichen Strukturierung von Legitimationsmustern.
Viele Autorinnen, die auf den Begriff zurückgreifen, untersuchen die kulturellen Muster von Geschlechtsunterscheidungen, die Struktur von Diskursen und die Stereotypenrepertoires bis hin zu deren Niederschlag im alltäglichen Sprechen und dem “doing gender“.
Manche Theoretikerinnen, so zum Beispiel Regina Becker-Schmidt, haben das Androzentrismuskonzept im erweiterten Rahmen einer gesellschaftstheoretischen Perspektive aufgegriffen. [8] Becker-Schmidt schreibt von der dreifachen Tarnung der Selbstreferentialität, die sich im androzentrischen „Herrenbewußtsein“ manifestiert: „Es verleugnet seine identitätslogische Prämisse, dass der Mann die Menschheit vertritt; es übersieht als Konsequenz die soziale Bedeutung des weiblichen Geschlechts in Geschichte und Gegenwart (und) es erklärt soziale Phänomene als geschlechtsneutral, die durch männliche Dominanz geprägt sind.“ (Becker-Schmidt 2017: 258) [9]
Das Androzentrismuskonzept bezieht sich auf die sexuierte Strukturierung von Allgemeinem und Besonderem in den kulturellen Repertoires und deren gesellschaftlichen Sedimentationen. In einer gesellschafts- und wissenschaftshistorischen Perspektive, die der Vermittlung unterschiedlicher Herrschaftsverhältnisse und Legitimationsformen nachgeht, bezeichnet dieser Androzentrismus zugleich eine kulturelle Hegemonie des europäischen, weißen, bürgerlichen Mannes. Das ist der „Mensch“, der seine imperialistischen und kolonialistischen Projekte als zivilisatorische Missionen rationalisieren konnte.
Sexismus: Geschlechtsbezogene Diskriminierung
Der Begriff des Sexismus ist eine aus dem englischen stammende Analogbildung zum Begriff des Rassismus, die in den 1960er Jahren in Umlauf kam. Wie man besonders an den aktuellen Debatten (#MeToo) wieder hautnah erleben kann, übernimmt er die politische Emphase des Patriarchatsbegriffs, geht aber ebenfalls mit perspektivischen Verengungen einher. Zentriert ist er um Fragen geschlechtsbezogener Diskriminierung im Allgemeinen und sexualisierter Gewalt im Besonderen. Zwar gab es in der Vergangenheit auch Ansätze, die nach der systemischen Dimension des Sexismus fragen, es überwiegen aber Auslegungen, die diskriminierenden Handlungen (Sprechakte und körperliche Übergriffe) im Zentrum haben.
Manchmal kommt der Sexismusbegriff auch im Dreierpack mit den Begriffen Rassismus und Klassismus. Alle stammen ursprünglich aus dem anglo-amerikanischen Diskurs.
Der Terminus classism wurde 1970 von der New Yorker Lesbengruppe „The Furies“ geprägt, die darauf aufmerksam machen wollte, dass es nicht nur Rassismus und Sexismus gäbe, sondern dass sie als Arbeitertöchter spezifische Benachteiligungen erführen. Auf Deutsch taucht er zum ersten Mal 1988 auf im Titel eines Buches von Anja Meulenbelt, die die englische Terminologie übernimmt: „Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus.“ Vor allem am Begriff des Klassismus wird die diskrimierungstheoretische Engführung dieser -ismen augenfällig.
Was sehen wir mit welchen Begriffen, was blenden wir aus?
Ich mache an dieser Stelle einen Schnitt, um auf die methodische Frage nach den Perspektivierungen feministischer Kritik einzugehen. Was sehen wir mit welchen Begriffen, was blenden wir aus?
Bezogen auf die eben vorgestellten Begriffe lässt sich grosso modo festhalten:
- Der feministische Patriarchatsbegriff zielte auf Herrschaft im Geschlechterverhältnis und damit auf gesellschaftliche Strukturzusammenhänge, die systematisch zu Lasten des weiblichen Geschlechts gehen.
- Der Androzentrismusbegriff fokussiert auf Manifestationen von Herrschaft im Bereich kultureller oder symbolischer Ordnungen bzw. auf eine spezifische Struktur der Legitimation männlicher Dominanz.
- Der Begriff „Sexismus“ akzentuiert Fragen der Diskriminierung nach Geschlecht und Formen sexualisierter Gewalt und ist ein eher akteurbezogenes Konzept, kein gesellschafts- oder herrschaftstheoretisches, auch wenn es in der Vergangenheit gelegentlich Versuche gegeben hat, seine systemische Dimension zu fassen.
Trotz dieser unterschiedlichen Akzentsetzungen sind alle drei Begriffe dadurch verbunden, dass sie an der klassischen Zentralperspektive feministischer Kritik festhalten. Die Zentralperspektive feministischer Kritik ist ausgerichtet auf die Relation Mann-Frau und ihr kritischer Impetus besteht in einer Politisierung dieser Vergleichsrelation. Methodisch heißt das: Wann immer Ungleichheit und Diskriminierung von Frauen festgestellt und skandalisiert werden, liegen dem Vergleiche in der Geschlechterrelation zugrunde. Dies gilt auch für den Androzentrismusbegriff, der auf die Herrschaftsform einer systematischen In-Kommensurabilisierung im Medium der Identitätslogik hinweist: sich unvergleichbar zu machen durch einen Entzug an Vergleichbarkeit.
Bei Vergleichen in der Geschlechterrelation sind zwei systematische Vergleichshinsichten im Spiel:
Erstens der Vergleich der relativen Positionierung der Geschlechter innerhalb bestimmter Sozialkategorien, Soziallagen oder soziogeographische Räume und zweitens der Vergleich der relativen Positionierung der Geschlechter quer durch unterschiedliche Sozialkategorien, Soziallagen oder soziogeographische Räume hindurch. Beides zusammen ermöglicht es zu erkennen, ob und in welcher Weise sich bestimmte Problemlagen durchhalten und unter welchen Bedingungen sie variieren oder sich wandeln können.
Wenn die amerikanische Anthropologin Gayle Rubin 1975 von der „endlosen Variabilität und monotonen Ähnlichkeit“ in den weltweiten Formen der Frauenunterdrückung spricht, dann bezieht sich das auf Beobachtungen genau in diesen beiden Vergleichshinsichten.
Die jeweiligen Ausprägungen der Unterdrückung variieren mit den sozialen und soziogeographischen Kontexten, systematisch beinhalten sie aber eine kontextübergreifende, weitgehend durchgängige Vormachtstellung von Männern gegenüber Frauen, die bei aller Verschiedenheit ihrer Erscheinungsformen im Einzelnen letztlich doch von monotoner Ähnlichkeit ist.
Wenn wir Rubins Aussage über die „endless variety and monotonous similarity“ von Phänomenen der Frauenunterdrückung zugrunde legen, dann lässt sich sagen, dass der Patriarchatsbegriff der Anfangsjahre mit seiner radikalen universalistischen Emphase eher auf die Durchgängigkeit von Frauenunterdrückung und asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern abzielte, den Unterschieden aber eher weniger Aufmerksamkeit widmete.
Zwar wurde in den seinerzeit gängigen Definitionen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass historische, geographische und soziallagenspezifische Variationen zu berücksichtigen seien. Die Betonung lag aber auf dem durchgängigen Charakter der Frauenunterdrückung in der Gegenwart, der ja auch die Basis der Vorstellung einer „global sisterhood“ und internationaler Solidarität darstellte.
Unterschiede und Ungleichheiten unter Frauen
Nehmen wir nun die Perspektivverschiebungen hinzu, die unter dem Etikett „Intersektionalität“ gebündelt werden sowie die Perspektivverschiebungen, die mit der queerfeministischen Kritik einhergehen.
Intersektionelle und queerfeministische Kritik haben die grundlegenden Relationierungen, auf die der Feminismus als kritische Politisierung der Mann/Frau-Relation verwiesen ist und bleibt, sowohl erweitert als auch dezentriert.
Schwerpunkt intersektioneller Kritik ist nicht der patriarchats-, androzentrismus- oder sexismuskritische Vergleich von Genus-Gruppen. Ihre Spezialität ist vielmehr die Frage von Intragruppendifferenzen. Im Zusammenhang der feministischen Grundlagenreflexion hat intersektionelle Kritik die Form einer Frage nach Unterschieden und Ungleichheiten unter Frauen* angenommen. Wer ist das epistemische und politische „Wir“ feministischer Kritik? Wer spricht von wo aus über was in wessen Namen? Wenn Sie an den universalisierenden Drive denken, der mit dem Patriarchatskonzept einhergegangen war, dann können Sie eine Ahnung davon bekommen, welche Sprengkraft der intersektionellen Perspektive potentiell zukommt. Während das Patriarchats-, das Androzentrismus- und das Sexismuskonzept eher das hervorheben, worin Frauen als negativ Betroffene verbunden sind, ungeachtet aller sonstigen Unterschiede, liegt das Schubmoment intersektioneller Ansätze eher auf der Frage, was sie unterscheidet, was sie potentiell voneinander trennt und sogar in hierarchisch angeordneten Privilegienstrukturen zueinander positioniert. Diese Frage ist nicht deckungsgleich mit beziehungsweise geht nicht auf in der Frage nach der Kontextvariabilität von Formen männlicher Dominanz und Frauenunterdrückung, die auch schon den klassischen Feminismus beschäftigte. Vor allem die Frage positionaler Privilegierungen und relativen Depravierungen im Frau-Frau-Vergleich birgt erhebliches Konfliktpotential für den Feminismus. Ob und inwieweit sie allerdings produktiv gemacht werden kann im Sinne sozialer und politischer Lernprozesse oder sich eher destruktiv auswirkt, hängt davon ab, inwieweit es gelingt, auch in der innerfeministischen Kritik die Kurzschlüsse eines „positionalen Fundamentalismus“ (Hark/Villa 2017:107) [10] zu vermeiden, die soziale Verortungen – ob „Oben“ oder „Unten“, „Drinnen“ oder „Draußen“ – in klar zurechenbare epistemische Verhängnisse, Privilegierungen, Authentisierungen und Zuständigkeiten verwandeln.
Intragruppendifferenz und die Frage gesellschaftlicher Verhältnisse
Die meisten intersektionellen Ansätze sind, in der Terminologie von Leslie McCall [11], als „intra-kategoriale“ Zugänge ausgearbeitet worden. Sie fragen nach Unterschieden innerhalb einer sozialen Kategorie oder, wie es Kimberle Crenshaw formuliert hat, nach „intra-group-differences“, nach Differenzierungen oder sogar Dominanzverhältnissen innerhalb diskriminierter Gruppen.
Aus meiner Sicht liegt hier ein systematisches Problem, weil die so genannte „intra-kategoriale“ Perspektive Fragen aufwirft, die letztlich nur auf einem „inter-kategorial“ (McCall) ausgearbeiteten theoretischen Hintergrund beantwortet werden können. [12] Nur dieser erlaubt es, die spezifische Verfasstheit der jeweiligen Verhältnisse in den Blick zu nehmen: Klassenverhältnisse sind anders verfasst und auf andere Weise gesellschaftlich eingebettet als Geschlechterverhältnisse oder rassistische Teilungs- und Dominanzverhältnisse. Solche Unterschiede müssen heuristisch spezifiziert werden, um der Frage ihrer Vermittlungen nachgehen zu können. An der Genus-Gruppe Frauen allein lassen diese sich ebenso wenig ablesen wie an anderen „Gruppen“ [13]. Nur auf einer „inter-kategorialen“(McCall) Folie in diesem Sinne wird es auch möglich, auf angemessene Weise zwischen Differenzen zu differenzieren und vor allem, sie zu gewichten: „Some differences are playful, others are poles of world historical systems of domination“ schreibt Donna Haraway [14]: „Epistemology is about knowing the difference.“
Bezogen auf den Patriarchatsbegriff als Begriff, der sich auf eine historische Herrschaftsform richtet, würde sich eine in McCalls Sinne „inter-kategoriale“ Perspektive übersetzen in die Frage nach der Vermittlung von Patriarchalismus mit anderen Formen gesellschaftlicher Herrschaft. Dies bezog sich im deutschen Sprachraum zunächst schwerpunktmäßig auf den Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchalismus. Im Diskurs des Black Feminism der 1970er und 80er Jahren vor allem in der historisch-materialistischen Tradition gefasst als Frage nach den Verhältnissen von Race, Class und Gender als „relations of dominance“ (Hill Collins).
Bezogen auf den Androzentrismusbegriff als Begriff, der sich auf den Bereich des Symbolischen richtet, würde die intersektionelle Perspektive (als „inter-kategoriale“) übersetzt in die Frage, wie sich androzentrische Ausrichtungen des Symbolischen mit anderen „relations of difference“ verbinden und welche Formen der De-Kommensurabilisierung und des „Othering“ sich in den großen kulturellen Ordnungen der Moderne manifestieren. („Der Mensch und seine Anderen“).
Bezogen auf Sexismus als Begriff, der sich schwerpunktmäßig auf Formen der Diskriminierung richtet, geht es intersektionell um das „doing difference“, formuliert als die Frage, wie Diskriminierungen nach Geschlecht mit anderen Formen und Prozessen der Diskriminierung zusammenwirken. In diesem Bereich, der Individuen als Angehörige diskriminierter Gruppen fokussiert, stößt man am ehesten auf eine Pluralisierung von Diskriminierungsformen (race, class, gender, religion, age, ability etcetera), deren Zusammenwirken thematisiert wird.
Queerfeministische Dezentrierung der Kritikperspektive
Während die intersektionelle Perspektive (zumindest in ihren „inter-kategorialen“ Perspektivierungen) das Geschlechterverhältnis als eine mit anderen sozialen Verhältnissen vermittelte hierarchische Relationierung von Männern und Frauen im Blick behält, nimmt die queerfeministische Perspektive eine einschneidende Perspektivverschiebung vor:
Weg von der politisierten Vergleichsrelation Mann-Frau und von Fragen nach Patriarchat und Androzentrismus hin zur Frage nach Differenzsetzungen an den normalisierenden Rändern der Geschlechtsunterscheidung selbst.
Skandalisiert werden nicht mehr Verhältnisse männlicher Überordnung und Privilegierung und deren vielfältige Manifestationen. Ins Zentrum geraten nun eher all diejenigen, die durch die Raster des Normalmodells von heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit fallen. Der politisierte Vergleich verlagert sich auf andere Relationierungen: Mehrheit/ Minderheit, Normal-Unnormal, Inklusion-Exklusion, Sichtbar – Unsichtbar, Intelligibel/ Nicht-Intelligibel.
Das ist zweifellos eine legitime, aber doch ganz andere Kritikperspektive als jene, die zwei Geschlechter - als wie immer auch Unterschiedene - voraussetzt und auf dieser Basis die Implikationen und großen gesellschaftlichen Folgen der Unterscheidung untersucht.
Aus queerfeministischer Perspektive ist nicht die Dominanz von Männern über Frauen und deren gesellschaftsstrukturelle Manifestationen das zentrale Problem, sondern die Art der Unterscheidung und die heterosexuelle Normierung von zwei Geschlechtern oder von Geschlechtern überhaupt. Nicht das Geschlechterverhältnis sondern die Geschlechtsunterscheidung steht im Mittelpunkt des Interesses. Manche verführte die Auseinandersetzung mit der Geschlechtsunterscheidung zu der Idee, dass nicht die Erweiterung, sondern nur eine Abschaffung von Geschlechtsunterscheidungen eine radikale und stimmige Kritikperspektive darstellen könnte.
An ihren Extrempolen schließen sich die klassisch-feministische und die queere Kritikperspektive wechselseitig aus. Das Kompositum „queer-feministisch“ wäre von hier aus gesehen ein Ding der Unmöglichkeit.
Aber auch die queere Kritik stellt, ebenso wie der klassische Feminismus, bekanntlich ein inhaltlich durchaus heterogenes Feld dar. Queere Kritik kann den Feminismus bereichern und hat es bereits getan. Nicht nur dadurch, dass sie das Augenmerk auf die Voraussetzungen und die Kehrseite sexueller und geschlechtlicher Unterscheidungen richtet. Da beide Seiten der Unterscheidung voneinander abhängen bringt einen das zum Beispiel zu der durchaus lehrreichen Frage, wie verrückt „Normales“ eigentlich ist und welches die psychosozialen Kosten der stummen Identitätszwänge und der Normalität sind.
Zur klassischen feministischen Frage nach Herrschaft und Ungleichheit im Verhältnis von Männern und Frauen trägt queerfeministische Theorie allerdings wenig bei. Zumal dann nicht, wenn die programmatisch eher dekonstruktive queere Kritik faktisch oft identitätstheoretische Formen annimmt. Zum Beispiel, indem sie Fragen der Anerkennung, die ja das zentrale Problem kultureller Intelligibilität und eines lebbaren Lebens betrifft, ummünzt in die Multiplizierung aller möglichen identitären und lifestyle-Varianten. Die Absurdität, zu der das in der politischen Praxis führen kann, ist bei den 60 Geschlechtsoptionen bei facebook zu besichtigen, etwa bei den Optionen „Gender Variant“, „Neither“, „Non-binary“ oder „Other“? Solche Kategorisierungen verwandeln Irritationen in Identitätsformen, die der Irritation Ausdruck verleihen und sie zugleich zum Verschwinden bringen.
Aber es gibt auch spannende Möglichkeiten queertheoretische Fragestellungen mit den klassisch-feministischen herrschafts- und gesellschaftstheoretischen Fragen zu verbinden. Ich denke zum Beispiel an das Foucaultsche Konzepts der Biopolitik und den historischen Zusammenhang dessen, was Foucault Allianzdispositiv (Verwandtschaftssysteme) und Sexualitätsdispositiv nennt. Hier gibt es reichlich Stoff für das joint venture kritischer Theorien, den historischen Formwandel gesellschaftlicher Herrschaft im Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Veränderungen zu bestimmen.
„Wenn wir die bleiben wollen, die wir sind, sind wir schon veraltet“
Ich hoffe, in meinem Vortrag zumindest für das Feld feministischer Kritik deutlich gemacht zu haben, dass die unterschiedlichen Begriffe und Perspektiven einander bestenfalls kritisieren, korrigieren, ergänzen und bereichern, aber wechselseitig nicht ersetzen können. So präsentieren sich aber häufig die Ansätze: als alternative Paradigmen, als Überwindung eines Veralteten oder als Avantgarden der Kritik. Oft genug zeigt sich darin ein Selbstmissverständnis, das auf einem Reflexionsmangel beruht: die Spezifik und damit die Begrenztheit der eigenen Perspektive kann nicht gesehen werden, weil und wenn sie absolut gesetzt wird. Es ist aus meiner Sicht dieser Reflexionsmangel, von dem die zentrifugalen Tendenzen im übergreifenden Feld feministischer Kritik verstärkt werden. Unter diesen Bedingungen wird feministische kritische Theorie zu einem äußerst voraussetzungsvollen Projekt. Zu einem unmöglichen Projekt, das wir aber, davon bin ich überzeugt, nicht nicht in Angriff nehmen können. Nicht, um auf der Höhe der Probleme unserer Zeit zu bleiben, sondern um überhaupt dahin zu kommen. Wenn wir die bleiben wollen, die wir sind, sind wir schon veraltet.
Der Vortrag wurde auf der Tagung: "Geschlecht, Differenz und Identität. Zum Verhältnis von Subjektivierung und Gewalt" der AStA der TU Darmstadt, am 09.03.2018 gehalten.
Endnoten:
[1] Hausen, Karin (1986): „Patriarchat. Vom Nutzen und Nachteil eines Konzepts für Frauengeschichte und Frauenpolitik“. In: Journal für Geschichte, 5, S. 12-21
[2] Gerhard, Ute (1990): „Patriarchatskritik als Gesellschaftsanalyse. Ein nicht erledigtes Projekt.“. In: Arbeitsgemeinschaft Interdisziplinäre Frauenfoschung und -studien (Hg.): Feministische Erneuerung von Wissenschaft und Kunst, Pfaffenweiler, S. 65-81.
[3] Manheim, Ernst (1936): „Beiträge zu einer Geschichte der autoritären Familie.“ In: Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse u.a.: Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Paris (Reprint: Lüneburg 1987: Zu Klampen Verlag), S.523-575.
[4] Auch die österreichische Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky wäre hier noch zu nennen. Sie arbeitet aber konzeptionell nicht mit dem Patriarchatsbegriff im engeren Sinne, sondern setzt das Konzept des „Männerbündischen“ für die Analyse politischer Herrschaft ein. Norbert Elias´ Vorschlag, den historisch auf (Haus)Väterherrschaft geeichten Begriff des Patriarchats durch den auf Männerherrschaft abzielenden Begriff der Andrarchie zu ersetzen, hat - soweit ich sehe - in der feministischen Diskussion kein Echo gefunden.
[5] Für eine ausführlichere vergleichende Darstellung der Zugangsweisen von Ursula Beer, Regina Becker-Schmidt und Ute Gerhard siehe: Anja Wolde: Geschlechterverhältnis und gesellschaftliche Transformationsprozesse. In: Regina Becker-Schmidt/ Gudrun-Axeli Knapp (Hg.) ( 1995): Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften, Frankfurt a.M./New York, S. 279-308.
[6] Zur Dialektik biologischer Aufklärung anregend: Christina von Braun: Blutsbande, Berlin 2018.
[7] Dazu eine Polemik von Hedwig Dohm von 1876, die ihren Zeitgenossen im Preußen Bismarcks galt: „O über dieses Geschwätz von der Sphäre des Weibes, den Millionen Frauen gegenüber, die auf Feld und Wiese, in Fabriken, auf den Straßen und in Bergwerken, hinter Ladentischen und in Bureaus im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot erwerben. Wenn die Männer vom weiblichen Geschlecht sprechen, so haben sie dabei nur eine ganz bestimmte Klasse von Frauen im Sinn: die Dame (…). Geht auf die Felder und in die Fabriken und predigt Eure Sphärentheorie den Weibern, die Mistgabel führen und denen, deren Rücken sich gekrümmt hat unter der Wucht centnerschwerer Lasten“.“ (Dohm 1986, Der Frauen Natur und Recht, Berlin 1876, S. 126)
[8] Die gesellschaftstheoretische Perspektive ist bei ihr doppelt angelegt: Zum einen übersetzt sie sich in die Frage, wie die Geschlechter im Geschlechterverhältnis vergesellschaftet, d.h. zueinander relationiert sind. Zum anderen geht es um die Frage, wie das Geschlechterverhältnis als Gesamtgefüge der Relationierungen der Geschlechter seinerseits vergesellschaftet, also in den Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Reproduktion eingelassen ist.
[9] Becker-Schmidt, Regina (2017): Früher – später; innen – außen. Feministische Überlegungen zum Ideologiebegriff, in: dies.: Pendelbewegungen – Annäherungen an eine feministische Gesellschafts- und Subjekttheorie. Aufsätze aus den Jahren 1991 bis 2015, Opladen, S. 249-273.
[10] Sabine Hark/ Paula-Irene Villa: Unterscheiden und Herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart, Bielefeld 2018
[11] McCall, Leslie (2005): The Complexity of Intersectionality, Signs: Journal of Women in Culture and Society 30 (3): 1771-1800.
[12] McCall unterscheidet „intra-kategoriale“, „inter-kategoriale“ und „anti-kategoriale“ Zugänge. Als Letztere bezeichnet sie dekonstruktivistische Ansätze.
[13] Zum Problem des „Gruppismus“ vergl. Brubakers, Roger (2007): Ethnizität ohne Gruppen, Hamburg: Hamburger Edition.
[14] Haraway, Donna (1991): A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century. In: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York, S. 149-181.