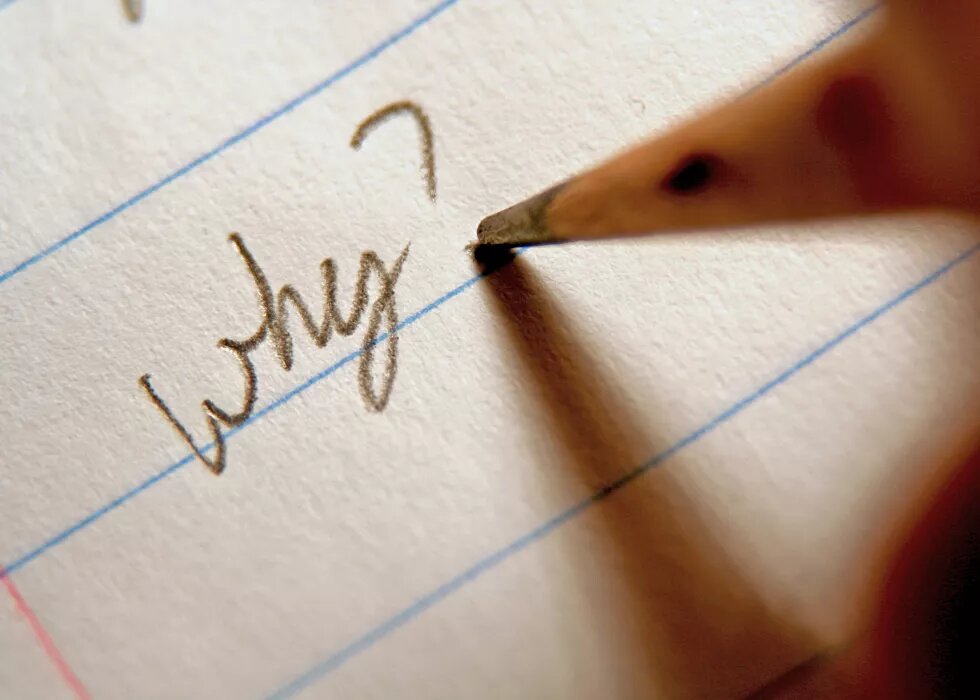
Vor 10 Jahren, zum 20. Jubiläum der Intersektionalitätstheorie, wurde Kimberlé Crenshaw im Rahmen einer Ringvorlesung nach Berlin eingeladen. Sie sollte einen Vortrag mit dem Titel „The Curious Resurrection of First Wave Feminism in the US Presidential Elections: An Intersectional Critique of the Rhetoric of Solidarity and Betrayal“ in einem großen Hörsaal halten. Danach sah das interne Programm ein gepflegtes Abendessen in kleiner Runde vor. Eine gute Chance für eine handverlesene Gruppe von Doktorand*innen und Professor*innen ein privates Wort mit der „Erfinderin“ der Intersektionalität zu wechseln. Ich und eine kleine Gruppe von BPoC, die sich einige Zeit zuvor als eine Art „aktivistische Lesegruppe“ zusammengeschlossen hatten, waren selbstverständlich nicht eingeladen. Aber wir hatten einen Plan, einen „Inside-man“ und waren entschlossen, Kimberlé in unsere BPoC-Runde zu holen. 2009 ist auch das Jahr, in dem ich mein Soziologiestudium abgeschlossen habe. Warm geworden bin ich mit den Sozialwissenschaften nie so ganz, obwohl mir nicht immer klar war, warum. Wir passten doch so gut zusammen! Und dennoch ließen sie mich immer unmissverständlich wissen: Das hat alles nichts mit dir zu tun.
An dem Tag von Crenshaws Gastvortrag war der Hörsaal proppenvoll. Viele hochkarätige Jurist*innen, Soziolog* innen und Professor*innen der Genderstudies, die alle ihren Teil zur Erweiterung, Ergänzung, Distanzierung und Potenzierung des Intersektionalitätskonzepts publiziert 82 hatten, waren anwesend. Ich erwartete einen Vortrag gespickt mit Rechtsbegriffen, Mehrebenendilemmata und Verfassungsinterna. Rückblickend kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass ich an diesem Abend eine der unterhaltsamsten und lehrreichsten Vorlesungen meiner Unizeit hören sollte. Eine der wenigen Vorlesungen, die ich inhaltlich von vorne bis hinten verstand, obwohl sie auf Englisch gehalten wurde und nicht soziologischer, sondern juristischer Natur war.
Kimberlé Crenshaw live zu sehen war für mich ein Highlight, denn ihre Arbeit gab unseren politischen, akademischen und aktivistischen Kämpfen einen soliden Boden. Und eines solchen bedurfte es 2009, als die stark angespannte Situation zwischen queeren Selbstorganisationen von Migrant*innen (sowie verbündeten MSO) und weißen, vorrangig schwulen Vereinen in Berlin immer weiter hochkochte. Letztere versuchten durch Demonstrationen, Kissins und Presseaktionen auf einen vermeintlich inhärenten Konflikt zwischen Migrant*innen und Homosexuellen hinzuweisen. Ihre Forderungen enthielten, neben dem Recht auf Ehe, vor allem härtere Strafen gegen „homophobe Übergriffe“ im Rahmen einer Hatecrime-Gesetzgebung und eine verstärkte Kooperation zwischen Polizei und LSBTI-Organisationen. Unnötig zu erwähnen, dass der Versuch, eine Betrachtungsweise vom Standpunkt queerer BPoC einzubringen, an fehlendem intersektionalen Bewusstsein scheiterte.
In ihrem Vortrag, der relativ kurzfristig in „Historicizing Intersectionality. A Disciplinary Tale“ umbenannt wurde, beginnt Crenshaw beim Anfang von allem. Sie teilt mit uns ihre berühmte Analogie der Straßenkreuzung, in der Race und Gender als Straßen gedacht werden und mit ihren jeweils eigenen Strukturen und -ismen befahren sind. Kommt es an dem Punkt, wo sich beide Straßen kreuzen, zu einem Unfall, versagen oftmals alle Rettungsversuche. 83 Der Rettungswagen fährt nur dann los, wenn die Verletzung eindeutig auf der Race- oder der Genderstraße passiert ist.
Crenshaw macht ihre Analogie an der Realität anhand des Rechtsbeispiels DeGraffenreid v. General Motors, fest. Noch ein paar Fragen aus dem Publikum – und fertig.
Bäm. Was war das? Hat sie wirklich auf einer Fachtagung für Quantenphysik das Periodensystem erklärt? Ja.
Nicht nur auf aktivistischer, sondern gerade auch auf universitärer Ebene wurde um das Jahr 2009 herum weiße Definitionsmacht mit den Zähnen und Klauen verteidigt. Auch an meine Uni war Intersektionalität als Konzept zwar schon durchgedrungen, allerdings schien man sich nicht ganz sicher zu sein, wie sich davon profitieren lasse. Meine Diplomarbeit über intersektionale Ansätze in der politischen Arbeit von FLTI* of Color überlebte nur knapp den Rat meiner Professor*innen, auch die „kritischen Seiten“ von Intersektionalität zu beleuchten und den vermeintlich umfassenderen Mehrebenenanalysen zweier weißer deutscher Akademikerinnen gegenüberzustellen. Die nicht hilfreichen Kommentare zum Aufbau meiner Leitfragen lauteten: „Wer wählt denn die relevanten Kategorien aus?“ „Ist Rassismus für Deutschland überhaupt relevant?“ Auch der mündliche Teil meiner Abschlussprüfung war ein großes Desaster. Im Bereich der Kultursoziologie wollte ich mich mit dem Begriff „Community“ auseinandersetzen. Laut Prüfer war dies aber zu wenig soziologisch und sollte stattdessen „ethnische Segregation“ lauten. Die Inhalte, so versprach er mir, wären dieselben. Ein Schmankerl am Rande: Meine mündliche Prüfung wurde um 60 Minuten überzogen, weil die Schriftführerin einen totalen Zusammenbruch erlebte, als ich Weiß-Sein als relevante Kategorie im Diskurs über Privilegien vorschlug. Indem Kimberlé Crenshaw beim Urschleim des Rassismus anfängt, gelingt ihr die Intervention, die 2009 im 84 deutschen Diskurs zur Intersektionalität dringend nötig war. Sie rückt unmissverständlich die Position Schwarzer Frauen* in den Mittelpunkt. Beleuchtet die unmögliche, widersprüchliche Realität, in der sich Schwarze FLTI und FLTI of Color ständig bewegen. Indem sie so klar spricht, bringt sie Intersektionalität weg vom „deutschen Wünschdir- was-Diskurs“ und zwingt die Hörer*innenschaft, sich mit Rassismus und Schwarzen Menschen im Zentrum von Theroriebildung auseinanderzusetzen.
Ach, und unsere Intervention lief nicht ganz wie geplant. Jedenfalls ließ sich Kimberlé nicht wie gedacht in ein anderes Restaurant umlenken. Stattdessen sprengten wir einfach mit einem Überraschungsauftritt die geplante Elitebubble und „entführten“ sie später nach Kreuzberg, Tequila trinken.


